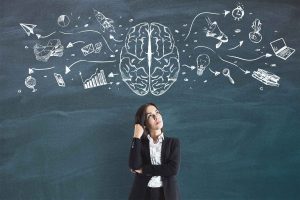Künstliche Intelligenz sorgt in der Kunstwelt für Aufregung – nicht wegen ihrer Kreativität, sondern wegen ihrer Effizienz im Umgang mit gängigen Inhalten und Formen. Während Pädagogen um literarische Tiefe bangen, zeigt sich: Wer wahre Formbeherrschung wie Kafka anstrebt, hat nichts zu befürchten. KI kombiniert Versatzstücke, liefert Trivialliteratur und Unterhaltung, bleibt jedoch ohne originären Ausdruck. Die Herausforderung für echte Kunstschaffende liegt nicht im Wettbewerb mit Maschinen, sondern im Bewahren und Weiterentwickeln künstlerischer Qualität jenseits algorithmischer Muster. KI ist keine Bedrohung, sondern ein Gradmesser.
Die Vertreter des gesellschaftlichen Subsystems «Kunst und Kreatives» erblicken in der KI eine Bedrohung. Diejenigen Künstler, die diese Bezeichnung wirklich verdienen, haben allerdings nichts zu befürchten.
Aufruhr herrscht im Allerheiligsten. Genauer gesagt: in den Künsten und anverwandten Kreativ-Gefilden. Ein Eindringling droht die dort waltende Autonomie zu stören. Oder gar das letzte Refugium authentisch menschlicher Souveränität zu verwüsten. Sein Name: Künstliche Intelligenz, gezüchtet und gefüttert vom profitgierigen Hightech-Business nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in China und sogar hierzulande. Der KI-Tsunami macht vor nichts halt und ist auch nicht mehr aufzuhalten. Das Wissen darum beschert immer mehr Kunstschaffenden und Kunstvermittlern – allen voran den Berufspädagogen – schlaflose Nächte und letzteren zahllose Überstunden in Gestalt von endlosen Lehrplanreform-Sitzungen.
Das ewige Dilemma der Pädagogen
Ein gewisser Grad an Aufregung ist sicher angebracht. Der panische Tenor, der häufig aus den medialen Kultur- und Gesellschafts-Ressorts der Medien ertönt, überhaupt nicht. Handeln wir also zu Beginn kurz die Bedenken der Pädagogen ab, bevor wir zu den interessanteren Involvierten – den Künstlern nämlich – kommen. Die Lehrkörper der westlichen Bildungswelt sorgen sich gegenwärtig massiv angesichts des drohenden Verlusts traditioneller literarischer Kenntnisse seitens ihrer Schützlinge. Das Argument: KI und insbesondere ChatGPT mache eine «echte» und «vertiefte» Lektüre schriftstellerischer Werke «überflüssig», indem sie Kurzzusammenfassungen auf Fingertouch liefere.
Falsch? Nein. KI liefert solches in der Tat. Aber das ist kalter Kaffee. Seit der Verfügbarkeit des guten alten Reclam-Führers für Romane und Theater-Texte sind Kurzzusammenfassungen allenthalben verfügbar und logischerweise extrem beliebt; wenn es um den reinen Inhalt geht. Und das ist der Knackpunkt in der ganzen KI-Diskussion. Denn Literatur ist nicht gleich Inhalt. Genauso wenig wie Musik, Malerei, Bildhauerei und Film. Das Wie und nicht das Was macht Kunst zu Kunst. Die besten Beispiele stammen tatsächlich aus der Literatur und der Filmkunst. Gerade, weil hier das Was so entscheidend zu sein scheint. Mit Betonung auf «scheint».
Inhalt ist nicht Qualität
Damit sind wir bei der leidigen, aber alles entscheidenden Frage der Qualität. Und diesbezüglich können wir der KI mehr als dankbar sein. Warum? Weil sie glasklar aufzeigt, dass es keinen Sinn macht, ob der Qualitätsfrage zu verzweifeln und die Flinte ins Korn zu werfen, wie Robert M. Pirsigs autofiktionale Ich-Figur in «Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten». Im Gegenteil. Denn KI kann inhaltlich alles zusammenfassen und mittlerweile auch «selbst» Literatur produzieren. Vorausgesetzt, dass es sich dabei um die simple Kombination von inhaltlich gängigen Textbausteinen handelt. Kindergeschichten und Trivialliteratur sind heute schon kein Problem für ChatGPT. Fantasy-Plots auch nicht. Wer ausser der zeitvertreibenden Unterhaltung keine anderen Ansprüche an Literatur und TV-Serien hat, kann also mit KI-Ware zufriedengestellt werden. Form spielt da eine extrem untergeordnete Rolle.
Kafka, der «gescheiterte» Formvollender
Nehmen wir im Kafka-Jubiläumsjahr Franz Kafka als Gegenbeispiel. Bei ihm ist alles Form. Weil der jeweils spärliche Inhalt von Kafkas Schreibweise überformt wird. Kafka ist mitnichten der Autor und Kritiker des Absurden oder der Bürokratie oder der absurden Bürokratie oder der bürokratischen Absurdität. Kafka ist der Meister der sprachlichen Sparsamkeit und der extremen Verkürzungen. Sein Vorsatz springt beim Lesen seiner Texte sofort ins Auge. Er lautet: Ich will formvollendet schreiben. Deshalb konnte er für sich selbst logischerweise nur scheitern. Und «befahl» seinem Freund Max Brod, alle seine Schriften zu verbrennen. Was dieser glücklicherweise nicht tat. Und somit Kafkas «Scheitern» formal und praktisch aufhob.
Die KI, die perfekte Lego-Spielerin
Nun sind natürlich nicht alle Schriftsteller Formkünstler wie Kafka. Aber das spielt keine Rolle. Wer formal etwas kann, hat von der KI nichts zu befürchten. Wer dagegen nur klischeehafte inhaltliche Textbausteine mehr oder weniger variiert aneinanderreiht allerdings schon. Dasselbe gilt erst recht für den mittlerweile ozeanischen Überfluss an popmusikalischen Elaboraten jeglichen Genres. J.K. Rowling und Taylor Swift kann das alles herzlich egal sein. Sie haben ihren Reibach mit «Harry Potter» respektive der «Eras Tour» schon gemacht.
Fazit
KI kann nicht denken und ist insofern nicht intelligent. Aber ihre algorithmischen Kombinationsfähigkeiten bezüglich bereits vorhandener und massenkulturell hochbeliebter Bausteine, Versatzstücke und Klischees können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Falls also die Kombination besagter Versatzstücke als Kunst durchgeht, ist KI die Künstliche Künstlerin par excellence.
Beat Hochuli
Beat Hochuli ist ein Schweizer IT-Journalist, der als freischaffender Autor mit Schwerpunkt auf Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) tätig ist. Seine Arbeit umfasst unter anderem Trendanalysen und Fachartikel zu Themen wie Augmented Reality, mobilen Anwendungen und digitalen Innovationen.